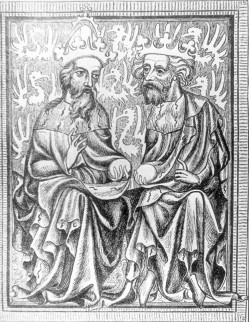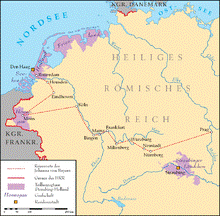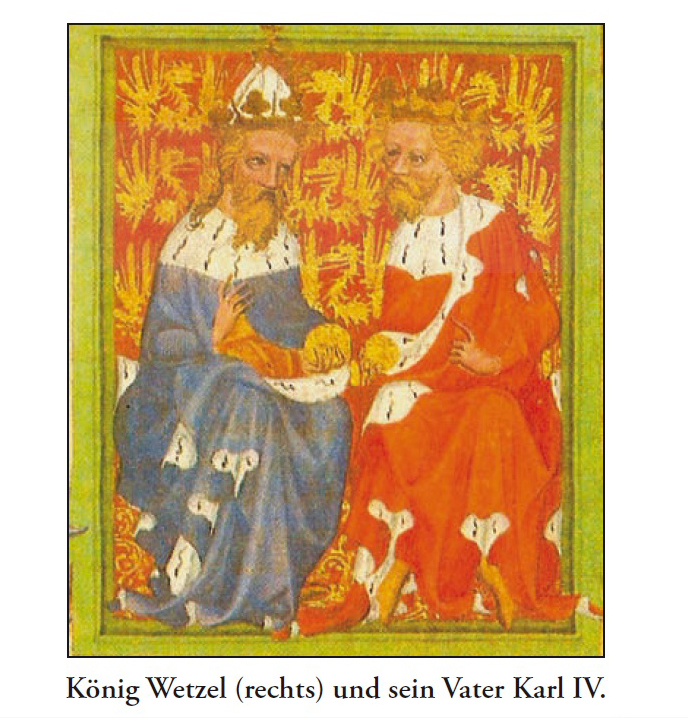Wenzel, Deutschlands schlechtester König
In der Stadt
Schon im Alter von zwei
Jahren ließ Wenzels Vater, Kaiser Karl IV., ihn 1363 zum König von Böhmen
krönen. Karl war ein kluger und
diplomatischer Herrscher, der sich sehr bemühte, das immer stärker divergierende
Deutsche Reich zusammenzuhalten. Allerdings begünstigte er sein
böhmisches Stammland in auffallender Weise und verlegte die kaiserliche
Hauptresidenz nach Prag.
·
1 von 6
Wenzel von Böhmen, eine
Blamage seiner Zunft
FOTO: A0009_DPAWenzel von Böhmen (r.) mit seinem
Vater Karl IV. Zeitgenössische Miniatur.
Nach dem Tod Karl IV. Ende 1378 übernahm der junge Wenzel die Regierung. Er verstand es
zunächst geschickt, die rivalisierenden Fürsten, Städtebünde und
Ritterbruderschaften zu neutralisieren. Irgendwelche Bestrebungen, die
Kaiserkrone zu
Am letzten Tag des Jahres 1386 geschah
eine persönliche Katastrophe. Einer der Jagdhunde fiel
Wenzels Gemahlin Johanna von Bayern an und biss sie zu Tode. Seit diesem Zeitpunkt veränderte sich Wenzels Wesen, er ergab sich
hemmungslos dem Alkohol, wurde träge und bösartig. Manchmal
bekam er furchtbare Wutanfälle. 1393 zerstritt er sich
mit dem Prager Erzbischof, ließ einige seiner Berater verhaften und foltern,
wobei er selbst Hand anlegte. Der Generalvikar Johann von Pomuk wurde
auf Wenzels Befehl an ein Holzkreuz gebunden und am
20. März
Sein
ständiger Begleiter war ein Henker
In der Folgezeit benahm
Wenzel sich wie ein unzurechnungsfähiger Despot.
Seine Begleiter waren jetzt nicht nur die Hunde, sondern auch ein Henker, den
er vertraulich „Gevatter“ nannte. Er soll sogar einen
Koch, dessen Speise nicht gelungen schien, zur Strafe auf den Bratspieß
gesteckt haben. Wahrscheinlich ist das nur ein
Gerücht, es zeigt aber, dass man dem König solche Untaten durchaus zutraute.
Das Deutsche Reich
versank derweil in Anarchie. Mehrere
Kurfürsten taten sich deshalb zusammen und am 20. August 1400 wurde Wenzel von
Böhmen als „unnützer, träger, unachtsamer Entgliederer und unwürdiger Inhaber
des Reiches“ für abgesetzt erklärt und statt dessen
der Pfalzgraf Ruprecht zum König gewählt.
Wenzel bekam daraufhin wieder einen
Wutanfall und ließ große Töne hören: „Ich will das
rächen oder darum tot sein. Ruprecht soll so tief hinab, als
er hoch auf den Stuhl gesetzt worden ist. Ich will ihn tot stechen oder er muß
Wenzel
brachte den Lehrbetrieb an der Prager Universität zum Erliegen
Nach seiner Entlassung
regierte Wenzel noch 16 Jahre in Böhmen – eigensinnig und despotisch, wie es
seine Art war. 1409 beschnitt er die
Freiheiten der Prager Universität. Daraufhin verließen
sämtliche deutschen Professoren und Studenten das Gebäude; der Lehrbetrieb kam
zum Erliegen. Anfangs mit der Reformbewegung des Jan Hus
sympathisierend, schwenkte Wenzel nach dessen Hinrichtung als
Ketzer 1415 um und erließ mehrere Edikte gegen die Hussiten.
Am 30. Juli 1419 kam es in der Prager Neustadt deshalb zum
Aufruhr. Ein Hussitenhaufe stürmte das Rathaus, warf den Bürgermeister
und mehrere königstreue Ratsherren aus dem Fenster, die vom wütenden Pöbel mit
Spießen und Heugabeln aufgefangen wurden. Wenzel war über diese Vorfälle so
entsetzt, dass ihn ein Schlaganfall traf, an dem er am
16. August
1419 starb. Mit seiner Person verkörperte er den Tiefpunkt des deutschen
Königtums.
Johanna
von Bayern (1362–1386)
Reiseroute
Johannas zu Wenzel im Jahre 1370
Johanna von Bayern (* 1362 vermutlich
in Den Haag; † 31. Dezember 1386 in Prag) war die zweitälteste Tochter Herzog Albrechts I. von Straubing-Holland. Sie
heiratete 1370 im Alter von acht Jahren den späteren böhmischen König und römisch-deutschen König Wenzel von Luxemburg,
der damals neun Jahre alt war.
Johanna reiste am 23.
August 1370 gemeinsam mit ihren Eltern von Den Haag über Rotterdam, Köln, Mainz undWürzburg nach Nürnberg. Als Geschenke
führten sie Räucheraale und Salzheringe mit. Am 18. September wurde Johanna in
Nürnberg den Vertretern des böhmischen Königs und römisch-deutschen Kaisers Karl IV. übergeben.
Während ihre Eltern sich
auf den Weg in ihre niederbayerische Residenz Straubing machten,
wurde Johanna nach Prag gebracht. Nachdem Karl am 21. September in Marseille einen
päpstlichen Dispens wegen der engen Verwandtschaft der
Eheleute erreicht hatte, fand acht Tage später ein symbolisches Beilager statt.
Tatsächlich vollzogen wurde die Ehe schließlich
Wenzel heiratete am 2. Mai
1389 Johannas Nichte 2. Grades Sophie von Bayern.
Literatur [Bearbeiten]
§
Dorit-Maria
Krenn, Joachim Wild: „Fürste
in der Ferne“. Das Herzogtum Niederbayern-Straubing-Holland 1353–1425. Haus der Bayerischen Geschichte, Augsburg 2003, ISBN 3-927233-86-2,
S. 15, 47 (Hefte zur bayerischen Geschichte und Kultur, Band 28).
§
Edmund von Oefele: Albrecht I., Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Baiern. In: Allgemeine Deutsche Biographie(ADB).
Band 1, Duncker & Humblot, Leipzig 1875, S. 230 f.
Sophie
von Bayern
|
|
Dieser Artikel behandelt die
Ehefrau König Wenzels von Böhmen. Ebenfalls so genannt wurde Sophie Friederike
von Bayern. |
|
Dieser Artikel oder
nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (bspw. Einzelnachweisen) ausgestattet. Die
fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst entfernt. Hilf bitte
der Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfügst.
Näheres ist eventuell auf der Diskussionsseite oder in der Versionsgeschichte
angegeben. Bitte entferne zuletzt diese Warnmarkierung. |
Sophie Euphemia von
Bayern (tschechisch Žofie Bavorská; * 1376; † 1425 in Preßburg) aus der Münchner Linie des Hauses Wittelsbach war die zweite Ehefrau desböhmischen Königs Wenzel IV.
Sophie war die einzige
Tochter Herzog Johanns II. von Bayern-München und seiner Ehefrau Katharina von Görz. Sie wuchs bei dessen
älterem Bruder Friedrich von Bayern-Landshut auf der Burg Trausnitz auf.
1388 nahm Friedrich, der ebenso wie der bis 1400 auch als römischer König amtierende Wenzel gern jagte, seine
Nichte nach Prag mit.
Die Hochzeit zwischen der zwölfjährigen Sophie und dem fünfzehn Jahre älteren,
nach dem Tod ihrer Verwandten Johanna von Bayern verwitweten König fand am 2. Mai
Wohl auch, weil diese Ehe
wie die zwischen Wenzel und Johanna zuvor kinderlos blieb, wurde Sophie erst
elf Jahre später, am 15. März 1400, zur Königin von Böhmen gekrönt. Ihr
Ehemann, der König, nahm an der Krönung nicht teil. Sophie hielt sich oft in den
Ländereien auf, die sie als Mitgift erhalten
hatte. Seit 1402 hing sie den Lehren des Predigers Jan Hus an,
die sie auch bei Hof lange verteidigte. 1419, nach Wenzels Tod, warf ihr Papst Martin V. deshalb sogar Ketzerei vor.
Ebenfalls 1419 wurde Sophie
von König Sigismund, einem
Halbbruder ihres verstorbenen Mannes, zur Regentin Böhmens ernannt, in dem
mittlerweile die Hussitenkriege tobten. Nachdem sie vergeblich
versucht hatte, einen Landfrieden zu erzielen, verzichtete sie jedoch
auf dieses Amt. Sigismund wurde zum König von Böhmen gekrönt, Sophie zog sich
nach Pressburg zurück. Dort starb sie am 26.
September 1425. Sophie von Bayern wurde im Pressburger Martinsdom bestattet.
Der Legende zufolge war der
spätere Brückenheilige Johannes Nepomuk 1393 Sophies Beichtvater. Angeblich
wurde Nepomuk nicht deswegen gefoltert und von der von ihrem Schwiegervater Karl IV. errichteten Karlsbrücke in die Moldau gestürzt, weil er sich gegen Wenzels
Kirchenpolitik gewandt hatte, sondern weil er sich geweigert hatte, dasBeichtgeheimnis zu brechen und dem König mitzuteilen,
was dessen Ehefrau Sophie ihm gebeichtet hatte. Johannes Nepomuk wurde 1721 selig- und 1729 heiliggesprochen. Er
gilt heute als Schutzpatron Böhmens und Bayerns.
|
Vorgängerin |
Amt |
Nachfolgerin |
|
Königin von Böhmen |
Normdaten: PND: 137989024 | Wikipedia-Personeninfo
Wenzel
(HRR)
König
Wenzel. Illustration aus derWenzelsbibel,
c.1398/1395
Wenzel von Luxemburg aus
dem Geschlecht der Luxemburger, Beiname: der Faule (auch Wenzeslaus, tschechisch Václav; * 26. Februar 1361 in Nürnberg; † 16. August 1419 auf
der Wenzelsburg,
tschechisch Nový hrad u
Kunratic, heute im Stadtgebiet von Prag), war seit seiner Krönung im Kindesalter
1363 bis zu seinem Tod 1419 als Wenzel
IV. König von Böhmen und von 1376 bis zu seiner Absetzung
1400 römisch-deutscher König. Von 1373 bis 1378 war
er zudem Kurfürst von Brandenburg; das Haus
Luxemburg vereinte somit für den Fall einer Königswahl zwei Kurstimmen, die
böhmische und die brandenburgische, auf sich. Er war mit Johanna von Bayernund Sophie von Bayern verheiratet; beide Ehen blieben
kinderlos.
Inhaltsverzeichnis
·
1 Leben o
1.1 Wahl und erste Regierungsjahre o
1.2 Machtkämpfe innerhalb der Familie |
Leben [Bearbeiten]
Wahl
und erste Regierungsjahre [Bearbeiten]
Wenzel war der älteste Sohn
Kaiser Karls IV. aus dessen dritter Ehe mit Anna von
Schweidnitz. Er war seit frühester Kindheit als Haupterbe
vorgesehen. Karl ließ ihm Siegel anfertigen und brachte ihm bereits als
Kleinkind bei, sich als wahrer Herrscher zu verhalten. Als Erzieher dienten ihm Ernst von
Pardubitz, später Johann Očko von Wlašim, die ihn zu einem
zwar gebildeten, aber unselbständigen und unschlüssigen Menschen heranzogen.
Schon 1363 wurde Wenzel zum König von Böhmen gekrönt.
Er wurde auch noch zu Lebzeiten seines Vaters am 10. Juni 1376 in Frankfurt am Main zum Rex Romanorum gewählt und vom Kölner Erzbischof Friedrich III. von Saarwerden am 6. Juli 1376 gekrönt. Nach dem Tod
seines Vaters trat Wenzel 1378 dessen Nachfolge als König des Heiligen Römischen Reichs an.
Reise
der ersten Ehefrau Wenzels nach Prag 1370
In den Auseinandersetzungen
mit der Kirche (Abendländisches Schisma), wobei er wie schon
sein Vater Papst Urban VI. als rechtmäßigen Pontifex anerkannte,
und den Reichsstädtebünden hatte er keine glückliche Hand. Es kam
zu Kampfhandlungen mit einem süddeutschen Städtebund, als er die schwäbischen Landvogteien den Habsburgern übertragen
wollte. Wenzel kümmerte sich fast gar nicht um die Reichsangelegenheiten. Er
kam erst 1383 nach Nürnberg, doch wollte der Städtebund den von ihm verordneten Landfrieden, der auch
erstmals die Einteilung des Reiches in Kreise vorsah, nicht anerkennen, da dies
dessen Auflösung bedeutet hätte. Mit demLandfrieden von
Eger stellte er sich
auf die Seite der Fürsten, aber gegen die städtischen Bünde. Was ihm in Böhmen
einigermaßen gelang, nämlich die Ordnung aufrechtzuerhalten, misslang ihm in
Deutschland. Zudem nahm Wenzels Verhalten mehr und mehr despotische Züge an. Zu
der allgemeinen Unzufriedenheit trugen auch seine unfähigen Berater bei.
Nachdem Wenzel sich zudem mit niederem Adel und bürgerlichen Beratern umgab,
formierte sich auch in Böhmen der Widerstand des Adels, der von der Unfähigkeit
Wenzels und seiner Brutalität genug hatte, die auch in der Folterung und
Ermordung des Prager Generalvikars Johann von
Nepomuk, des verhassten Beichtvaters seiner Frau, zum Ausdruck kam.[1]
Machtkämpfe innerhalb der Familie [Bearbeiten]
Schließlich brachen auch
innerhalb der Luxemburger-Dynastie Machtkämpfe aus, angefacht durch seinen
Cousin Jobst von Mähren.
Am 8. Mai 1384 wurde Wenzel von den Vertretern des Adels in Königshof gefangen genommen. Den König setzte
man in Prag fest und Jobst übernahm die Verwaltung. Gleichzeitig bemühte sich
Wenzels jüngerer Bruder, Johann von
Görlitz, um dessen Befreiung. Wenzel wurde daraufhin auf die Burg Wildberg inOberösterreich verlegt. Es kam zu erfolgreichen
Verhandlungen über die Freilassung des Regenten, allerdings mit für ihn harten
Bedingungen, die Wenzel später jedoch nicht einhielt. Nach seiner Rückkehr
musste er sich verpflichten, die Rebellen, darunter Kaspar und Guandar von
Starnberg, Heinrich III. von Rosenberg, Heinrich III. von Neuhaus und andere böhmische Adelige, die am Aufstand
teilgenommen hatten, nicht zu bestrafen.
1394 lud Jobst von Mähren
führende Mitglieder des böhmischen Adels nach Prag ein,
darunter Heinrich von Rosenberg auf Krumau, Heinrich der Ältere von Neuhaus, Brenek von Fels und Schwihau, Otto der Ältere von Bergow, Heinrich Berka von Duba auf Hohenstein, Wilhelm von Landstein, Jan Michalec z Michalovic a na
Mladé Boleslavi, Boček II. von Podiebrad und Boresch IX. von Riesenburg der Jüngere. Am 5.
Mai 1394 veröffentlichten sie eine gemeinsame Erklärung für ein Vorgehen zum
Wohle des tschechischen Volkes und gegen den König.
Im April überfielen Boresch
von Riesenberg und Bohuslav von Schwanberg mit weiteren Herren die Burg Toužim und
nahmen Propst Georg fest, den Boresch anschließend auf derBurg Riesenburg festhielt. Der König reagierte
wutentbrannt auf diesen Affront und befahl dem Prager Burggrafen Otto von Berg,
ein Heer zusammenzustellen und die Aufständischen zu bestrafen. Otto folgte,
zog jedoch mit den Soldaten nicht gegen die Rebellen, sondern gegen den König
selbst. Während seiner Rückkehr von seiner Burg Žebrákwurde Wenzel
gefangen genommen und im Weißen Turm auf der Prager Burg inhaftiert.
Wenzel wurde gezwungen,
seinen Cousin, den Markgrafen Jobst, zum Hauptmann des böhmischen Königreichs
zu ernennen. Ihm schlossen sich dann weitere böhmische Aristokraten an. Auf die
Seite Wenzels schlug sich jedoch sein Bruder Johann von Görlitz, der in Kuttenberg eine Armee zusammenstellte. Die
Rebellen zogen sich daraufhin mit dem König nach Südböhmen zurück. Zwischen
beiden Lagern entbrannte ein erbitterter Krieg. Johann ließ die Höfe und
Ländereien der Rosenberger plündern
und besetzteBudweis. Am 30. Juni 1394 schloss man Frieden
und Wenzel wurde wieder entlassen.
Der Frieden hielt nicht,
und Ende 1394 trafen sich die Landesherren, diesmal in Alttabor wieder. Markgraf Jobst erhielt
Unterstützung vom Meißner Markgrafen Wilhelm und dem von Verhandlungen mit seinem
Bruder enttäuschten Johann von Görlitz. Die neue Koalition, an der sich diesmal
auch Boresch VII. der Ältere beteiligte, traf sich mit dem König
auf seiner Burg Žebrák. In den von den höheren Adeligen vorgelegten Forderungen
sollten diese alle wichtigen Ämter erhalten und damit das Land kontrollieren
und verwalten. Auch dieses Friedensabkommen hielt nicht lange. Wenzel
inhaftierte den Markgrafen Jobst und Boček II. von Podiebrad; gegen andere,
darunter auch die Riesenburger, sollte ein Heer aufgestellt werden, angeführt
von Bořivoj ze Svinař.
1395 wurde Jobst entlassen
und zu Verhandlungen zugelassen, dies jedoch auf Kosten des Königsbruders
Johann von Görlitz. 1396 versuchte Wenzel, die Lage wieder in den Griff zu
bekommen und bat seinen Bruder Sigismund um Hilfe. Durch dessen Vermittlung
konnte am 2. April 1396 ein weiterer Frieden geschlossen werden, wiederum zu
Gunsten der böhmischen Landesherren.
1397 verschärfte sich die
Lage wieder, da der König neben den Mitgliedern des hohen Adels auch wieder
seine Günstlinge im niederen Adel bei der Verteilung von Posten
berücksichtigte. Der neu entstandenen Opposition unter der Führung des
mährischen Markgrafen Prokop,
die sich zum Ziel erklärte, gegebenenfalls die Günstlinge des Königs auch unter
Anwendung von Gewalt zu beseitigen, schloss sich auch Boresch an. Verhandlungen
fanden am 11. Juni 1397 auf der Burg Karlštejn statt. Die Interessen des abwesenden
Königs vertrat Herzog Hanusch. Während der Verhandlungen ließen die Abtrünnigen
des Königs die Ausgänge des Verhandlungssaales mit Bewaffneten besetzen und
beriefen vier der königstreuen Berater in den Konferenzraum. Sobald diese
eintraten, beschuldigte Hanusch den eingetroffenen Burchard Strnada z Janovic, ein Verräter zu
sein, zog sein Schwert und durchbohrte ihn. Johann Michales von Michalowitz und Boresch von Riesenburg warfen sich
auf die übriggebliebenen waffenlosen Räte und töteten sie. LediglichMarkolt z Vrutic gelang die Flucht, er starb jedoch
kurz darauf an seinen schweren Verletzungen. Daraufhin begaben sich die Mörder
zum König in Königshof und gestanden ihm die Tat. Wenzel nahm
die Nachricht über den Tod seiner Anhänger apathisch auf. Einen Monat später
bezichtigte er selbst seine ermordeten Räte des Verrats.
1400
– Abwahl [Bearbeiten]
Am 20. August 1400 wurde
Wenzel als eynen unnüczen,
versümelichen, unachtbaren entgleder und unwerdigen hanthaber des heiligen
Romischen richs (hochdeutsch:
unnützer, träger, unachtsamer Entgliederer und unwürdiger Inhaber des Heiligen
Römischen Reiches)[2] von
den Erzbischöfen von Mainz, Trier und Köln und Ruprecht, dem Pfalzgrafen bei
Rhein, auf der Burg Lahneck in Oberlahnstein für abgesetzt erklärt. Ruprecht aus dem Hause Wittelsbach wurde am folgenden Tag in Rhens von
den gleichen vier Kurfürsten zum König gewählt.
König ohne Krone – die letzten Jahre [Bearbeiten]
Auch in Böhmen regte sich
aufs Neue die Opposition des hohen Adels, diesmal wieder mit dem Meißner
Markgrafen Wilhelm, der jedoch nach dem Friedensvertrag von 1401 aus dem Land
wieder abziehen musste. Auf Druck der Aristokraten berief Wenzel seinen Bruder Sigismund
nach Böhmen, mit dem er in Königgrätz 1402 eine Vereinbarung traf, mit der
er ihm faktisch die Verwaltung von Böhmen überließ und ihm die böhmische Krone
nach seinem Tod versprach. Sigismund sollte ihm dafür zum Rückgewinn der
Reichskrone verhelfen. Der ungarische König übernahm die Macht und besetzte
nach und nach die Königsburgen, hatte jedoch mit dem Versprechen, das er seinem
Bruder gegeben hatte, keine Eile.
Wenzel begehrte auf. Sein
Bruder ließ ihn daraufhin am 6. März
Böhmischer König blieb
Wenzel bis zu seinem Tod, zumal er formal weiter auf sein Recht als
römisch-deutscher König pochte. 1411 wurde der Bruder Wenzels, Sigismund, neuer
römisch-deutscher König. Beide Brüder einigten sich, so dass Sigismund auch auf
Wenzels Hausmacht hoffen
konnte.
Im Jahre 1419 spitzte sich
der Konflikt mit den Hussiten zu.
Ende Juli 1419 gelang es ihnen, Prag in ihre Hand zu bekommen, wozu auch
Wenzels immer mehr als tyrannisch empfundene Herrschaft beigetragen hat. Wenzel
floh, doch starb er schon am 16. August desselben Jahres. Nach Wenzels Tod trat
Sigismund auch dessen Nachfolge als böhmischer König an.
Bewertung [Bearbeiten]
In seinem persönlichen
Charakter wird Wenzel als Paranoiker und als Tyrann beschrieben, der mit der
Reitpeitsche um sich schlug, seine großen Hunde auf unliebsame Menschen in
seiner Umgebung hetzte oder diese sogar aus fadenscheinigsten Gründen hinrichten
ließ.[3] Er
spielt auch eine Hauptrolle in der Geschichte von Johann von
Nepomuk, den er angeblich deshalb in die Moldau hat werfen lassen, weil er ihm die
Beichtgeheimnisse seiner Frau nicht habe preisgeben wollen. In Wahrheit ging es
um politische Differenzen. Die meiste Zeit seiner Regierung soll Wenzel in
einem Zimmer mit seinen Jagdhunden eingeschlossen verbracht haben.
Wenzel war vermutlich seit
dem Tod seiner ersten Frau Alkoholiker; das wurde am 23. März 1398 zum
öffentlichen Skandal, als der betrunkene König Wenzel nicht am Festmahl des
französischen Königs Karl VI. in Reims teilnehmen
konnte. Zweimal war Wenzel festgesetzt worden (1394 und noch einmal 1402–03,
das letzte Mal unter Zutun seines Bruders Sigismund, der von Wenzel als
Reichsvikar zu einem seiner Stellvertreter ernannt worden war). Wenzel, der
sich nie ernsthaft um die Kaiserkrone bemühte (was sonst alle römisch-deutschen
Könige des Spätmittelalters getan hatten) und sich nicht mit
fähigeren Ratgebern umgab, als es noch Zeit gewesen wäre das Blatt zu wenden,
bleibt eine Gestalt ohne sympathische Züge. Politisch muss man ihm vorwerfen,
dass ihm trotz seiner Bildung und seiner Wissensneigung sowohl der
Realitätssinn als auch das Gespür für die Politik fehlten, die noch seinen
Vater ausgezeichnet hatten. Seine politischen Entscheidungen waren nicht
voraussehbar. Die Lösung von Problemen verschob er meist oder reagierte
unüberlegt und übereilt. Er verlor die weisen Ratgeber seines Vaters und umgab
sich mit einem Hof, der sich meist aus Angehörigen der unteren Adelsschicht
zusammensetzte, die umso ehrgeiziger und unnachgiebiger handelten. Im Land kam
es dadurch zu immer neuen Konflikten, die nicht nur die politische sondern auch
die wirtschaftliche Entwicklung hemmten.
In Böhmen verstärkte die
Unbeliebtheit Wenzels die Herausbildung eines tschechischen Nationalcharakters,
der sich vor allem durch den Gegensatz zum Deutschen definierte.
Literatur [Bearbeiten]
§
Marco Innocenti: Wenzel IV.. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 24, Nordhausen 2005, ISBN 3-88309-247-9, Sp.
1521–1531.
§
Martin Kintzinger: Wenzel. In: Bernd
Schneidmüller, Stefan Weinfurter (Hrsg.): Die deutschen Herrscher des
Mittelalters. Historische Portraits von Heinrich I. bis Maximilian I.
(919–1519)(Bibliografie). S. 433–445, 594–595, Beck, München 2003, ISBN 3-406-50958-4,
§
Wilhelm Klare: Die Wahl Wenzels von Luxemburg zum
römischen König 1376 (zugleich Dissertation an der Universität Münster 1989). Lit, Münster und Hamburg 1990, ISBN 3-88660-559-0.
§
Theodor Lindner: Wenzel. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 41, Duncker &
Humblot, Leipzig 1896, S. 726–732.
§
Heinz Rieder: Wenzel. Ein unwürdiger König.
Zsolnay, Wien und Hamburg 1970 (ohne ISBN).
§
Herbert Rosendorfer: Deutsche Geschichte. Teil 2: Von der Stauferzeit bis zu König
Wenzel dem Faulen. Mit 7 Stammtafeln dtv 13152,
München 2003, ISBN 978-3-423-13152-0.
Weblinks [Bearbeiten]
![]() Wikisource: Wenzel – Quellen und
Volltexte
Wikisource: Wenzel – Quellen und
Volltexte
![]() Commons: Wenzel –
Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Commons: Wenzel –
Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
§
Literatur von und
über Wenzel (HRR) im
Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
Einzelnachweise [Bearbeiten]
1. ↑ Rosendorfer, Herbert: Deutsche
Geschichte - ein Versuch, Vom Morgendämmern der Neuzeit bis zu den
Bauernkriegen, S. 24
2. ↑ Absetzungsurkunde Wenzels, abgedruckt
in Quellensammlung zur Geschichte der Deutschen Reichsverfassung in Mittelalter
und Neuzeit / bearb. von Karl Zeumer, Seite 223-226, im Volltext bei Wikisource
3. ↑ Rosendorfer, Herbert: Deutsche
Geschichte - ein Versuch, Vom Morgendämmern der Neuzeit bis zu den
Bauernkriegen, S.
|
Vorgänger |
Amt |
Nachfolger |
|
Römisch-deutscher König |
||
|
König von Böhmen |
||
|
Kurfürst von Brandenburg |
|
|
|
Herzog von Luxemburg |
Normdaten: PND: 118631349 | LCCN: n82011955 | VIAF: 72187208 | WorldCat | Wikipedia-Personeninfo
·
Mann
|
|
|
|
|
|
|
|
1306 - 1307 |
Rudolf von Habsburg ∞ ... |
||||
|
|
Der Sohn
des Deutschen Königs Albrecht I. rückte mit seinem Vater Albrecht nach der Ermodung Wenzel III. in Böhmen ein und wurde als König anerkannt. Durch die
Heirat mit Richsa, der Schwiegermutter Wenzels II., erwarb er auch den
polnischen Königstitel. Kurz darauf starb er. |
||||
|
Johann von Luxemburg „der Blinde“ ∞ Elisabeth von Böhmen |
|||||
|
|
Die Stände wandten sich nun an
den neuen Deutschen König Heinrich IX. aus dem Hause Luxemburg. Sie erreichten eine Eheschließung von Elisabeth,
der Tochter Wenzels II. mit Johann von Luxemburg, dem Sohn Heinrichs. Johann wurde zum böhmischen
König gewählt und bestätigt. Er konnte für Böhmen die Oberlausitz, das
Egerland und ganz Schlesien gewinnen. Johann führte auch den Titel des Königs
von Polen, auf den er im Jahre 1335 gegen die Bestätigung des Erwerbes von
Schlesien verzichtete. |
||||
|
1346 - 1378 |
Karl von Luxemburg ∞ Blanca von Valois |
||||
|
|
Karl, der
Sohn Johanns, erreichte im Jahre 1344 die für immer Bestand behaltende
Abtrennung des Prager Stuhls von der Mainzer Kirchenprovinz und die Erhebung
Prags zum Erzbistum mit Olmütz und dem neugegründeten Bistum Leitomischl als
Suffragane. Er erbaute die Burg Karlstein bei Prag, wo die Kronjuwelen
aufbewahrt wurden. 1348 gründete er die Universität von Prag. Der ungeheure kulturelle und materielle Aufstieg
führte seiner Regierung führte zu religiösen Gegenbewegungen, die Karl
seinerseits ebenso förderte, wie das traditionelle Kloster- und Ordneswesen. |
||||
|
König Wenzel (IV.) von Luxemburg ∞ Johanna von
Niederbayern |
|||||
|
|
Wenzel war einer der unfähigsten Herrscher und steht
so in krassem Gegensatz zu seinem Vater. Wo immer man hinschaut hat er in eklatantem
Maße versagt. Einen Konflikt mit dem Erzbischof löste er, indem er den
Generalvikar Johannes von Nepomuk foltern und ertränken ließ. Dies war eines
der schwersten Verbechen, die je ein christlicher Herrscher begangen hat. Doch
damit nicht genurg, Wenzel förderte in erschütterndem Ausmaß den die Massen
fanatisierenden ethnischen Haß gegen Juden und Deutsche. Im „Kuttenberger
Dekret“ diskriminierte er die deutsche Hochschulnation, so daß diese nach
Leipzig fliehen mußte, wo sie die noch heute bestehende Universität
gründeten. |
||||
|
Sigismund von
Luxemburg |
|||||
|
|
Sigismund war deutscher König, König von Ungarn, König von
Böhmen, Markgraf von
Brandenburg und Kaiser. In Böhmen hatte er mit den
ultranationalistish-demokratischen Hussiten der verschiedensten
Schattierungen bis hin zum fanatischen Bolschewismus zu kämpfen. Erst 1434
wurden die Fanatiker besiegt, allerdings im Wesentlichen von den gemäßigten
Hussiten. Im Ergebnis wurden weite Teile des Kirchengutes säkularisirt,
die Geistlichkeit aus dem Landtag verbannt und eine bis zum heutigen Tage
andauernde Konfessionsspaltung besiegelt. |
||||
|
1438 - 1439 |
König Albrecht I. von Habsburg |
||||
|
|
Albrecht,
der Schwiegersohn Sigismunds, war bereits Herzog von Österreich und Markgraf
von Mähren, als er zum König von Böhmen gewählt wurde. Er starb an der Ruhr.
Elisabeth gebar danach Ladislaus Posthumus. |
||||
|
1437 |
Ungarn. |
||||
|
1438 |
Böhmen. Kasimier Jagello teilweise Gegenkönig |
||||
|
1438 |
Wahl zum
römischen König, keine Kaiserkrönung wg. + |
||||
|
Ladislaus
Posthumus von Habsburg |
|||||
|
|
|
Sohn Königs Albrecht II. Die böhmischen Stände
erzwangen von Friedrich III. seine Herausgabe,
Podiebrad regiert (in seinem Namen...) weiter in Prag. |
|||
|
1440/1445 |
In der
Nacht der Geburt Ladislaus’ ließ seine Mutter die hl. Stefanskrone aus der
Burg Visegrad an der Donau durch eine Hofdame entwenden, die das mit einem
entwendeten Schlüssel bewerkstelligte (!!!). Die Hofdame brachte die Krone
auf einem Donauschiff von Visegrad nach Komorn, wo der Neugeborene sofort
gekrönt wurde. Am nächsten Tage reisten alle
weiter nach Wien an den Hof des Onkels, Kaiser Friedrich
III. |
||||
|
|
+
Giftmord? Läukemie? |
||||
|
1458 - 1471 |
Georg von Kunstadt und Podiebrad |
||||
|
|
1452 |
Georg von Podiebrad war Führer der Utarquisten im
Hussittenkrieg. 1448 nahm er Prag ein und ließ sich als Landesverweser
legalisieren. Reichsverweser für den minderjährigen Ladislaus
Posthumus, trat heimlich zum Katholizismus über |
|||
|
1466 |
gebannt |
||||
|
Ladislaus II.
Jagellonczik, Jagellone |
|||||
|
|
Ladislaus war der Sohn von Kasimir IV. von Polen. Vater Ludwigs II., erbte Böhmen von Posthumus, da er dessen Neffe
war. Mußte allerdings das Nachfolgerecht der Habsburger bei Ausbleiben des
männlichen Erben anerkennen. |
||||
|
1516 - 1526 |
Ludwig II.,
Jagellone |
||||
|
|
König
Ludwig II., der Sohn Jagellonczyks ertrank auf der Flucht nach der Schlacht
von Mohács. |
||||
|
1526 - 1564 |
Ferdinand I.
von Habsburg |
||||
|
|
Kaiser Ferdinand I. - Bruder und Nachfolger Karls V.
Gattin: Anna, Tochter von Jagiellonczyk, Kg. von Böhmen und Ungarn. Ab nun
ununterbrochene Herrschaft der Habsburger in Böhmen bis
heute. |
||||
|
1564 - 1576 |
Maximilian II. von Habsburg |
||||
33. Wenzel von
Böhmen – Eine königliche
Skandalnummer
In der Stadt
Reims wollte König Karl VI. von Frankreich am 24. März
1398 den
deutschen König Wenzel empfangen. Beide Herrscher hatten
vereinbart, über
die Beilegung der christlichen Kirchenspaltung zu beraten. Aber als die Herzöge
von Berry und Bourbon zu Wenzel kamen, um
ihn zum
Festbankett mit Karl VI. zu geleiten, mussten sie befremdet den
Rückzug antreten,
da sie den König völlig betrunken vorfanden. Es war
nicht die einzige
Blamage, welche Wenzel dem Ansehen des deutschen
Königtums
zufügte.
Schon im Alter
von zwei Jahren ließ Wenzels Vater, Kaiser Karl IV., ihn
1363 zum König
von Böhmen krönen. Karl war ein kluger und diplomatischer Herrscher, der sich
sehr bemühte, das immer stärker divergierende Deutsche Reich zusammenzuhalten.
Allerdings begünstigte er
sein böhmisches
Stammland in auffallender Weise und verlegte die kaiserliche Hauptresidenz nach
Prag.
König Wetzel
(rechts) und sein Vater Karl IV.
Nach dem Tod Karl
IV. Ende 1378 übernahm der junge Wenzel die Regierung. Er verstand es zunächst
geschickt, die rivalisierenden Fürsten,
Städtebünde und
Ritterbruderschaften zu neutralisieren. Irgendwelche
Bestrebungen, die
Kaiserkrone zu erlangen, unternahm er nie, was für88
einen
römisch-deutschen König recht ungewöhnlich war und in den
vergangenen
Jahrhunderten nie vorgekommen war. Lieber ging Wenzel
auf die Jagd. Er
betrieb dies so leidenschaftlich, dass er Tag und Nacht
von einer Meute
riesiger Jagdhunde umgeben war.
Am letzten Tag
des Jahres 1386 geschah eine persönliche Katastrophe.
Einer der
Jagdhunde fiel Wenzels
Gemahlin Johanna von Bayern an und
biss sie zu Tode.
Seit diesem Zeitpunkt veränderte sich Wenzels Wesen, er ergab sich hemmungslos
dem Alkohol, wurde träge und bösartig.
Manchmal bekam er
furchtbare Wutanfälle. 1393 zerstritt er sich mit
dem Prager
Erzbischof, ließ einige seiner Berater verhaften und foltern,
wobei er selbst
Hand anlegte. Der Generalvikar
Johann von Pomuk wurde auf Wenzels Befehl an ein Holzkreuz gebunden und
am 20. März
Königin nicht
verraten wollte.
In der Folgezeit
benahmWenzel sich wie ein unzurechnungsfähiger Despot. Seine Begleiter waren
jetzt nicht nur die Hunde, sondern auch ein
Henker, den er
vertraulich „Gevatter“ nannte. Er soll sogar einen Koch,
dessen Speise
nicht gelungen schien, zur Strafe auf den Bratspieß gesteckt haben.
Wahrscheinlich ist das nur ein Gerücht, es zeigt aber, dass
man dem König
solche Untaten durchaus zutraute.
Das Deutsche
Reich versank derweil in Anarchie. Mehrere Kurfürsten
taten sich
deshalb zusammen und am 20. August 1400 wurde Wenzel
von Böhmen als
„unnützer, träger, unachtsamer Entgliederer und unwürdiger Inhaber des Reiches“
für abgesetzt erklärt und stattdessen der
Pfalzgraf
Ruprecht zum König gewählt.
Wenzel bekam daraufhin
wieder einen Wutanfall und ließ große Töne
hören: „Ich will
das rächen oder darum tot sein. Ruprecht soll so tief hinab, als er hoch auf
den Stuhl gesetzt worden ist. Ich will ihn tot stechen
oder er muss mich
tot stechen!“ Natürlich geschah nichts dergleichen.
Vielmehr wurde
Wenzel 1402 von seinem eigenen Halbbruder Sigmund,
dem späteren
Kaiser, gefangen genommen und 19 Monate zu Wien in
haftiert. 1403
bestätigte der Papst seine Absetzung als deutscher König.
Nach seiner
Entlassung regierte Wenzel noch 16 Jahre in Böhmen – eigensinnig und
despotisch, wie es seine Art war. 1409 beschnitt er die
Freiheiten der
Prager Universität. Daraufhin verließen sämtliche deut-89
schen Professoren
und Studenten das Gebäude; der Lehrbetrieb kam
zum Erliegen.
Anfangs mit der Reformbewegung des Jan Hus sympathisierend, schwenkte Wenzel
nach dessen Hinrichtung als Ketzer 1415 um
und erließ
mehrere Edikte gegen die Hussiten.
Am 30. Juli 1419
kam es in der Prager Neustadt deshalb zum Aufruhr.
Ein
Hussitenhaufen stürmte das Rathaus und warf den Bürgermeister
und mehrere
königstreue Ratsherren aus dem Fenster, die vom wü-
tenden Pöbel mit
Spießen und Heugabeln aufgefangen wurden. Wenzel
war über diese
Vorfälle so entsetzt, dass ihn ein Schlaganfall traf, an dem
er am 16. August
1419 starb. Mit seiner Person verkörperte er den Tiefpunkt des deutschen
Königtums.
34. Ein
Hohenzoller bändigt die Raubr
schen Professoren
und Studenten das Gebäude; der Lehrbetrieb kam
zum Erliegen.
Anfangs mit der Reformbewegung des Jan Hus sympathisierend, schwenkte Wenzel
nach dessen Hinrichtung als Ketzer 1415 um
und erließ
mehrere Edikte gegen die Hussiten.
Am 30. Juli 1419
kam es in der Prager Neustadt deshalb zum Aufruhr.
Ein
Hussitenhaufen stürmte das Rathaus und warf den Bürgermeister
und mehrere
königstreue Ratsherren aus dem Fenster, die vom wü-
tenden Pöbel mit
Spießen und Heugabeln aufgefangen wurden. Wenzel
war über diese
Vorfälle so entsetzt, dass ihn ein Schlaganfall traf, an dem
er am 16. August
1419 starb. Mit seiner Person verkörperte er den Tiefpunkt des deutschen
Königtums.
34. Ein
Hohenzoller bändigt die Raubritter
Der 30. April
1415 bildete einen Höhepunkt des allgemeinen Konzils
zu Konstanz.
Kaiser Sigmund begrüßte an diesem Tag in der BodenseeStadt den Burggrafen
Friedrich VI. von Nürnberg. Unter seiner Fahne
mit dem roten
Adler empfing der Zoller die feierliche Belehnung mit
der Würde eines
Kurfürsten und Markgrafen von Brandenburg sowie
den damit
verbundenen Rang eines Reichserzkämmerers. Damit begann
der Aufstieg der
Dynastie Hohenzollern, welcher 450 Jahre später in der
Ausrufung zum
deutschen Kaiser kulminierte.
Die Mark
Brandenburg stellte Anfang des 15. Jahrhundertseinen
rechtsfreien Raum dar. Weil das einheimische Herrschergeschlecht ausgestorben
war, hatte Kaiser Karl IV. das Land 1361 seinem Sohn Wenzel dem
Schon im Alter
von zwei Jahren ließ Wenzels Vater, Kaiser Karl IV., ihn
1363 zum König
von Böhmen krönen. Karl war ein kluger und diplomatischer Herrscher, der sich
sehr bemühte, das immer stärker divergierende Deutsche Reich zusammenzuhalten.
Allerdings begünstigte er
sein böhmisches
Stammland in auffallender Weise und verlegte die kaiserliche Hauptresidenz nach
Prag.
König Wetzel
(rechts) und sein Vater Karl IV.
Nach dem Tod Karl
IV. Ende 1378 übernahm der junge Wenzel die Regierung. Er verstand es zunächst
geschickt, die rivalisierenden Fürsten,
Städtebünde und
Ritterbruderschaften zu neutralisieren. Irgendwelche
Bestrebungen, die
Kaiserkrone zu erlangen, unternahm er nie, was fü
Faulen und später
dessen Cousin Jobst von Mähren übertragen. Beide
hielten sich
stets außerhalb Brandenburgs auf und ließen der Anarchie
freien Lauf.
Raubritter durchzogen das Land und brachten den Handel
fast zum
Erliegen. Die Herzöge von Pommern überzogen viele wehrlose
Städte mit Krieg,
der Erzbischof von Magdeburg ließ Rathenow plündern. Die Missstände erreichten
einen Höhepunkt, als der berüchtigte
Ritter Dietrich
von Quitzow im Herbst 1410 ohne Fehdeansage die
Stadt Berlin
überfiel und teilweise in Brand steckte.
Nachdem Markgraf
Jobst Anfang 1411 gestorben war, fiel Brandenburg
an den Kaiser
Sigmund zurück. Ihm war klar, dass die Situation im Land
auf ein Chaos
zusteuerte. Deshalb ernannte er am 8. Juli 1411 den Burg
einen
römisch-deutschen König recht ungewöhnlich war und in den
vergangenen
Jahrhunderten nie vorgekommen war. Lieber ging Wenzel
auf die Jagd. Er
betrieb dies so leidenschaftlich, dass er Tag und Nacht
von einer Meute
riesiger Jagdhunde umgeben war.
Am letzten Tag
des Jahres 1386 geschah eine persönliche Katastrophe.
Einer der
Jagdhunde fiel Wenzels Gemahlin Johanna von Bayern an und
biss sie zu Tode.
Seit diesem Zeitpunkt veränderte sich Wenzels Wesen, er ergab sich hemmungslos
dem Alkohol, wurde träge und bösartig.
Manchmal bekam er
furchtbare Wutanfälle. 1393 zerstritt er sich mit
dem Prager
Erzbischof, ließ einige seiner Berater verhaften und foltern,
wobei er selbst
Hand anlegte. Der Generalvikar Johann von Pomuk wurde auf Wenzels Befehl an ein
Holzkreuz gebunden und am 20. März
Königin nicht
verraten wollte.
In der Folgezeit
benahmWenzel sich wie ein unzurechnungsfähiger Despot. Seine Begleiter waren
jetzt nicht nur die Hunde, sondern auch ein
Henker, den er
vertraulich „Gevatter“ nannte. Er soll sogar einen Koch,
dessen Speise
nicht gelungen schien, zur Strafe auf den Bratspieß gesteckt haben.
Wahrscheinlich ist das nur ein Gerücht, es zeigt aber, dass
man dem König
solche Untaten durchaus zutraute.
Das Deutsche
Reich versank derweil in Anarchie. Mehrere Kurfürsten
taten sich
deshalb zusammen und am 20. August 1400 wurde Wenzel
von Böhmen als
„unnützer, träger, unachtsamer Entgliederer und unwürdiger Inhaber des Reiches“
für abgesetzt erklärt und stattdessen der
Pfalzgraf
Ruprecht zum König gewählt.
Wenzel bekam
daraufhin wieder einen Wutanfall und ließ große Töne
hören: „Ich will
das rächen oder darum tot sein. Ruprecht soll so tief hinab, als er hoch auf
den Stuhl gesetzt worden ist. Ich will ihn tot stechen
oder er muss mich
tot stechen!“ Natürlich geschah nichts dergleichen.
Vielmehr wurde
Wenzel 1402 von seinem eigenen Halbbruder Sigmund,
dem späteren
Kaiser, gefangen genommen und 19 Monate zu Wien inhaftiert. 1403 bestätigte der
Papst seine Absetzung als deutscher König.
Nach seiner
Entlassung regierte Wenzel noch 16 Jahre in Böhmen – eigensinnig und
despotisch, wie es seine Art war. 1409 beschnitt er die
Freiheiten der
Prager Universität. Daraufhin verließen sämtliche deut
33. Wenzel von
Böhmen – Eine königliche
Skandalnummer
In der Stadt
Reims wollte König Karl VI. von Frankreich am 24. März
1398 den
deutschen König Wenzel empfangen. Beide Herrscher hatten
vereinbart, über
die Beilegung der christlichen Kirchenspaltung zu beraten. Aber als die Herzöge
von Berry und Bourbon zu Wenzel kamen, um
ihn zum
Festbankett mit Karl VI. zu geleiten, mussten sie befremdet den
Rückzug antreten,
da sie den König völlig betrunken vorfanden. Es war
nicht die einzige
Blamage, welche Wenzel dem Ansehen des deutschen
Königtums
zufügte.
Schon im Alter
von zwei Jahren ließ Wenzels Vater, Kaiser Karl IV., ihn
1363 zum König
von Böhmen krönen. Karl war ein kluger und diplomatischer Herrscher, der sich
sehr bemühte, das immer stärker divergierende Deutsche Reich zusammenzuhalten.
Allerdings begünstigte er
sein böhmisches
Stammland in auffallender Weise und verlegte die kaiserliche Hauptresidenz nach
Prag.
König Wetzel
(rechts) und sein Vater Karl IV.
Nach dem Tod Karl
IV. Ende 1378 übernahm der junge Wenzel die Regierung. Er verstand es zunächst
geschickt, die rivalisierenden Fürsten,
Städtebünde und
Ritterbruderschaften zu neutralisieren. Irgendwelche
Bestrebungen, die
Kaiserkrone zu erlangen, unternahm er nie, was fü
33. Wenzel von
Böhmen – Eine königliche
Skandalnummer
In der Stadt
Reims wollte König Karl VI. von Frankreich am 24. März
1398 den
deutschen König Wenzel empfangen. Beide Herrscher hatten
vereinbart, über
die Beilegung der christlichen Kirchenspaltung zu beraten. Aber als die Herzöge
von Berry und Bourbon zu Wenzel kamen, um
ihn zum
Festbankett mit Karl VI. zu geleiten, mussten sie befremdet den
Rückzug antreten,
da sie den König völlig betrunken vorfanden. Es war
nicht die einzige
Blamage, welche Wenzel dem Ansehen des deutschen
Königtums
zufügte.
Schon im Alter
von zwei Jahren ließ Wenzels Vater, Kaiser Karl IV., ihn
1363 zum König
von Böhmen krönen. Karl war ein kluger und diplomatischer Herrscher, der sich
sehr bemühte, das immer stärker divergierende Deutsche Reich zusammenzuhalten.
Allerdings begünstigte er
sein böhmisches
Stammland in auffallender Weise und verlegte die kaiserliche Hauptresidenz nach
Prag.
König Wetzel
(rechts) und sein Vater Karl IV.
Nach dem Tod Karl
IV. Ende 1378 übernahm der junge Wenzel die Regierung. Er verstand es zunächst
geschickt, die rivalisierenden Fürsten,
Städtebünde und
Ritterbruderschaften zu neutralisieren. Irgendwelche
Bestrebungen, die
Kaiserkrone zu erlangen, un
33. Wenzel von
Böhmen – Eine königliche
Skandalnummer
In der Stadt
Reims wollte König Karl VI. von Frankreich am 24. März
1398 den
deutschen König Wenzel empfangen. Beide Herrscher hatten
vereinbart, über
die Beilegung der christlichen Kirchenspaltung zu beraten. Aber als die Herzöge
von Berry und Bourbon zu Wenzel kamen, um
ihn zum
Festbankett mit Karl VI. zu geleiten, mussten sie befremdet den
Rückzug antreten,
da sie den König völlig betrunken vorfanden. Es war
nicht die einzige
Blamage, welche Wenzel dem Ansehen des deutschen
Königtums
zufügte.
Schon im Alter
von zwei Jahren ließ Wenzels Vater, Kaiser Karl IV., ihn
1363 zum König
von Böhmen krönen. Karl war ein kluger und diplomatischer Herrscher, der sich
sehr bemühte, das immer stärker divergierende Deutsche Reich zusammenzuhalten.
Allerdings begünstigte er
sein böhmisches
Stammland in auffallender Weise und verlegte die kaiserliche Hauptresidenz nach
Prag.
König Wetzel
(rechts) und sein Vater Karl IV.
Nach dem Tod Karl
IV. Ende 1378 übernahm der junge Wenzel die Regierung. Er verstand es zunächst
geschickt, die rivalisierenden Fürsten,
Städtebünde und
Ritterbruderschaften zu neutralisieren. Irgendwelche
Bestrebungen, die
Kaiserkrone zu erlangen, unternahm er nie, was füternahm er nie, was fü
|
|